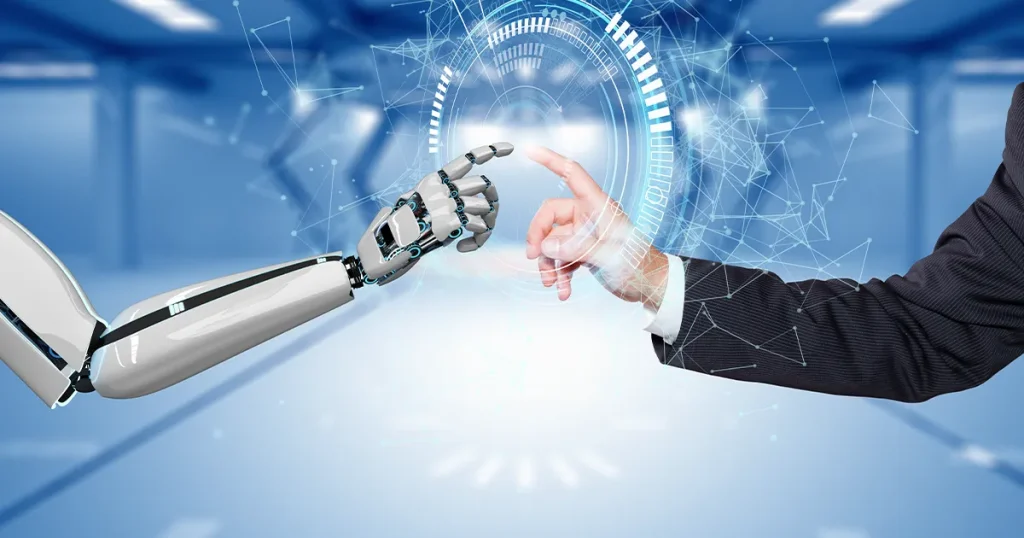
{"de":{"code":"de","id":"3","native_name":"Deutsch","major":"1","active":"1","default_locale":"de_CH","encode_url":"0","tag":"de-CH","missing":0,"translated_name":"Deutsch","url":"https:\/\/zvoove.ch\/wissen\/blog\/als-die-ki-ploetzlich-mit-am-tisch-sass","country_flag_url":"https:\/\/zvoove.ch\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/de.svg","language_code":"de"},"fr":{"code":"fr","id":"4","native_name":"Fran\u00e7ais","major":"1","active":0,"default_locale":"fr_CH","encode_url":"0","tag":"fr-CH","missing":1,"translated_name":"Franz\u00f6sisch","url":"https:\/\/zvoove.ch\/fr","country_flag_url":"https:\/\/zvoove.ch\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/fr.svg","language_code":"fr"},"it":{"code":"it","id":"27","native_name":"Italiano","major":"1","active":0,"default_locale":"it_CH","encode_url":"0","tag":"it-CH","missing":1,"translated_name":"Italienisch","url":"https:\/\/zvoove.ch\/it","country_flag_url":"https:\/\/zvoove.ch\/wp-content\/plugins\/sitepress-multilingual-cms\/res\/flags\/it.svg","language_code":"it"}}
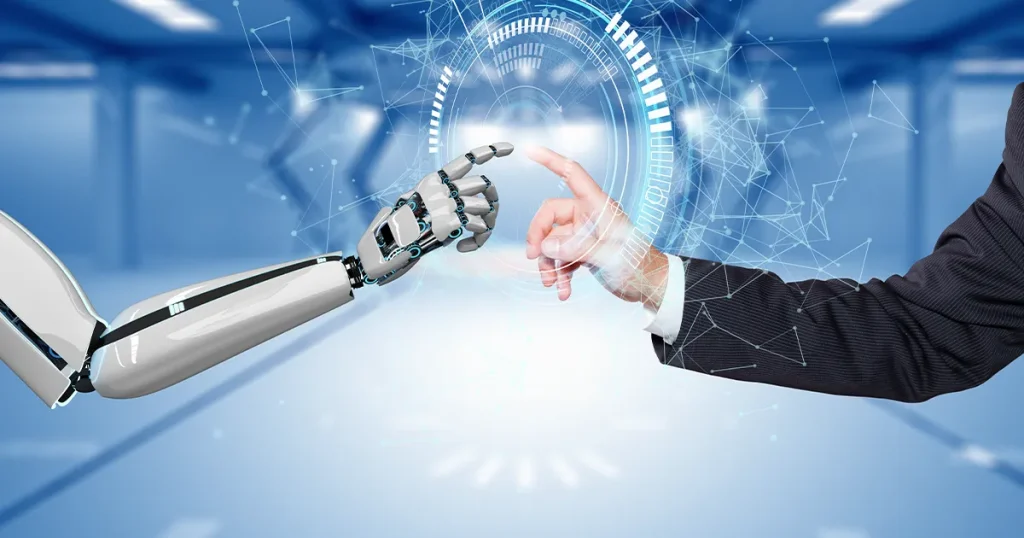
Ende 2022 hat sich etwas verändert – und viele haben es zuerst gar nicht richtig bemerkt. Ein neues Tool wurde veröffentlicht. Es heißt ChatGPT. Und mit einem Mal war künstliche Intelligenz nicht mehr nur ein Thema für Tech-Nerds, sondern mitten im Alltag angekommen. Texte schreiben? Ging plötzlich im Chat. Programmcode verstehen? Kein Problem. Übersetzen? Schnell, flüssig und erstaunlich präzise.
Seither ist kaum ein Monat vergangen, ohne dass neue KI-Anwendungen auftauchen. Die Arbeitswelt sortiert sich neu – und damit auch die Welt der Personaldienstleisterinnen und -dienstleister. Aufgaben, die früher Stunden gedauert haben, sind in Minuten erledigt. Entscheidungen basieren nicht mehr nur auf Intuition, sondern auf Mustern und Daten. Und die Suche nach dem passenden Profil? Läuft heute teils automatisiert.
Klar ist: KI ist längst kein Zukunftsprojekt mehr. Auch in der Schweiz verändert sie gerade, wie HR funktioniert.
Seit ChatGPT in den digitalen Alltag eingezogen ist, hat sich rund um generative KI ein ganzes Ökosystem gebildet. Innerhalb weniger Monate sind Tools entstanden, die in vielen Betrieben so selbstverständlich genutzt werden wie Outlook oder der Terminkalender. Besonders in der Personalvermittlung ist das Tempo rasant – und der Nutzen konkret spürbar.
Ein Überblick über die aktuell spannendsten KI-Werkzeuge:
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer heute durch Apps wie WhatsApp, Canva oder LinkedIn scrollt, nutzt oft KI ohne es zu merken. Auch im Büroalltag übernehmen smarte Systeme immer mehr Routinejobs. Nicht alles lässt sich automatisieren, aber viel mehr als noch vor einem Jahr.
Künstliche Intelligenz wirkt heute oft wie ein Quantensprung, doch die Grundlagen sind alles andere als neu. Bereits in den 1950er-Jahren stellte der britische Mathematiker Alan Turing die berühmte Frage: Können Maschinen denken? Nur wenige Jahre später, 1956, wurde an einer Konferenz in den USA der Begriff „Artificial Intelligence“ geprägt – mit dem Ziel, Maschinen das logische Denken und Problemlösen beizubringen.
Was damals revolutionär klang, blieb jedoch lange theoretisch. Zwar tüftelten Forschende an lernfähigen Algorithmen und Expertensystemen, doch im Alltag war davon kaum etwas zu spüren. KI fristete als Spielerei in Schachprogrammen oder in speziellen Industrieanwendungen ein Schattendasein.
Erst als die Datenberge wuchsen, die Rechenpower rasant zunahm und neue Ansätze im Machine Learning dazukamen, begann die Wende. Plötzlich war KI nicht mehr nur ein Forschungsthema, sondern fand ihren Weg in die Praxis.
Kaum war die Basis geschaffen, breiteten sich KI-Anwendungen still und leise aus. Lange Zeit war sie ein Thema für Nerds, Forschende und IT-Cracks. Wer sich mit neuronalen Netzen oder Machine Learning auseinandersetzte, brauchte Wissen, Geduld und viel Rechenleistung. Zwar wurden die Systeme im Hintergrund immer besser, doch im Alltag war davon kaum etwas spürbar. Übersetzungen klangen oft holprig, Sprachassistenten waren eher Spielzeug als echte Hilfe und autonome Autos? Nicht mehr, als ein spannendes Zukunftsprojekt.
Doch dann kam die Wende. Die neue Generation von KI-Tools machte plötzlich Fortschritte und wurde für alle zugänglich. Mit ein paar Wörtern lassen sich heute realistische Bilder erzeugen, Texte schreiben oder Meetings zusammenfassen. Und das alles ganz ohne Informatikstudium.
Das ist der grosse Unterschied: KI ist kein abstraktes Forschungsthema mehr, sondern ein Werkzeug, das mitten im Alltag angekommen ist. Sie hilft beim Brainstorming, sortiert Daten oder formuliert Nachrichten – und das schneller, präziser und oft kreativer, als man es selbst könnte.
Klar, nicht alles funktioniert auf Anhieb. Aber das Potenzial ist riesig. Diese neue KI denkt nicht für uns, aber sie denkt mit. Und das verändert, wie wir arbeiten – Schritt für Schritt.
Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv diskutiert wie der Einfluss von KI auf unsere Jobs. Wird sie uns ersetzen? Wohl kaum. Aber sie verändert unsere Arbeitsweise grundlegend. Tools wie ChatGPT oder Microsoft Copilot übernehmen repetitive Aufgaben, schaffen Raum für das, was wirklich zählt: strategisches Denken, kreative Lösungen oder den direkten Austausch mit Menschen.
Was sich in vielen Büros bereits spürbar zeigt, wird nun durch eine Schweizer Studie klar bestätigt: Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Produktivität deutlich zu steigern – und zwar schon in naher Zukunft. Die Mehrheit der befragten Unternehmen rechnet laut einer Untersuchung der Innovate Switzerland Community mit spürbaren Effizienzgewinnen durch den Einsatz von KI. Fast 70 Prozent erwarten bereits in den nächsten fünf Jahren eine Zunahme der Produktivität. Fast jede:r Zweite glaubt sogar, dass der Effekt schon in den kommenden zwei Jahren spürbar wird.
Gleichzeitig bietet KI laut Studie enormes Innovationspotenzial. 86 Prozent der Teilnehmenden sind überzeugt, dass KI die Innovationskraft von Unternehmen deutlich beflügeln kann – gerade in einem wirtschaftlich dynamischen Umfeld wie der Schweiz. Auch die Rentabilität dürfte steigen, wenn Prozesse effizienter und Entwicklungen zielgerichteter ablaufen.
Besonders interessant: Auch kleinere Unternehmen sehen Chancen. Mit spezialisierten, ressourcenschonenden Modellen können auch KMUs von KI profitieren, ohne riesige Datenmengen vorhalten zu müssen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Es besteht grosser Bedarf an Know-how. Wer das Potenzial nutzen will, muss die Technologie nicht nur einsetzen, sondern auch verstehen.
Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Während viele Branchen profitieren, zeigt sich auch, dass die Auswirkungen von KI nicht alle gleich betreffen. Eine aktuelle Analyse der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) warnt davor, dass insbesondere Berufe mit hohem Anteil an administrativen Tätigkeiten zunehmend automatisiert werden könnten. Gerade im tertiären Sektor, etwa in Assistenz- und Sekretariatsfunktionen, sind Frauen deutlich überrepräsentiert – und damit einem höheren Risiko ausgesetzt. In wohlhabenden Ländern gelten laut ILO fast zehn Prozent der typischerweise von Frauen ausgeübten Jobs als potenziell gefährdet. Bei männerdominierten Berufen liegt dieser Anteil mit 3,5 Prozent deutlich niedriger.
Was das bedeutet? KI kann Arbeitsprozesse verbessern oder Jobs grundlegend verändern. Damit dieser Wandel nicht zu einer neuen Form der Ungleichheit führt, braucht es gezielte Weiterbildung, klare Strategien und einen offenen Blick für faire Transformation.
In der Temporärarbeit geht es oft schnell, präzise und effizient zu. Anfragen flattern rein, Einsätze müssen besetzt, Verträge geprüft und Rückfragen beantwortet werden – am besten alles gleichzeitig. Genau hier entfaltet künstliche Intelligenz ihr volles Potenzial. Statt sich durch Tabellen und Papierberge zu kämpfen, übernehmen smarte Systeme den Datenkram – und lassen Raum für das, was zählt: den persönlichen Kontakt, die passende Besetzung, den perfekten Match.
Ein paar Beispiele aus der Praxis:
1. Prozesse, die sich von selbst bewegen
Stundenzettel kontrollieren, Rechnungen erstellen, Reportings zusammenstellen – alles Aufgaben, die Zeit fressen und oft mit viel Copy-Paste verbunden sind. KI sorgt hier für einen echten Wandel: Sie automatisiert Abläufe, erkennt Abweichungen frühzeitig und läuft still im Hintergrund. Die Folge? Weniger Fehler, mehr Zeit und entspanntere Teams.
2. Vorausschau statt Bauchgefühl
Wer morgen gefragt ist, lässt sich heute schon erahnen – wenn man die richtigen Daten lesen kann. KI wertet Markttrends, Einsatzpläne und Bewerber:innen-Pools aus und hilft so, den Personalbedarf gezielter vorherzusagen. Das macht Einsatzplanung vorausschauender und das Recruiting schlagkräftiger.
3. Die Nadel im Heuhaufen finden
Die Suche nach der idealen Person für einen Einsatz wird durch KI schneller und treffsicherer. Sie übernimmt das Durchsuchen von Lebensläufen, ordnet Fähigkeiten zu und erstellt passende Shortlists. Intelligente Systeme lernen mit jeder Suche dazu und erkennen Zusammenhänge, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind.
4. Bürokratie? Läuft nebenbei.
Verträge prüfen, Einsatzvereinbarungen kontrollieren oder gesetzliche Vorgaben im Blick behalten: All das lässt sich mit KI unterstützen. Die Systeme erkennen fehlende Angaben, schlagen Formulierungen vor und vermeiden so Stolperfallen, bevor sie entstehen.
5. Immer erreichbar, immer freundlich
Ob Lohnabrechnung, Einsatzort oder Ferienregelung: Fragen gibt es viele. Virtuelle Assistenten und Chatbots stehen rund um die Uhr bereit, beantworten Standardanfragen schnell und zuverlässig. Das entlastet nicht nur das interne Team, sondern schafft auch bei Mitarbeitenden Vertrauen und Zufriedenheit.
6. Neue Spielräume für Menschlichkeit
Was KI nicht kann: Gespräche führen, Vertrauen aufbauen, mit Fingerspitzengefühl vermitteln. Aber genau dafür bleibt mehr Zeit, wenn repetitive Aufgaben automatisiert ablaufen. Temporärbüros, die diese Entlastung nutzen, können sich stärker auf interne und externe Beziehungspflege konzentrieren.
Die Technologie ist einsatzbereit, die Werkzeuge sind vorhanden. Jetzt geht es darum, sie klug in die eigenen Abläufe zu integrieren.
Ein Beispiel aus der Praxis: zvoove Cockpit. Die Software wurde speziell für die Personaldienstleistung entwickelt und kombiniert Bewerber- und Kundenmanagement in einem System. Mithilfe von KI und aktuellen Arbeitsmarktdaten findet sie passende Talente schneller und genauer. Ob freie Mitarbeitende vermittelt oder neue Stellen besetzt werden – das System schlägt aktiv passende Profile vor. So verkürzt sich der Weg zum Match spürbar.
Der Clou: Die Software denkt mit. Sie erkennt Zusammenhänge, priorisiert Optionen und unterstützt selbst in komplexen Situationen. Gerade wenn Zeitdruck herrscht oder Aufträge kurzfristig besetzt werden müssen, spielt das System seine Stärken aus.
Auch in der Administration wird das Potenzial deutlich. Wer auf digitale, gut gepflegte Prozesse setzt, kann etwa in der Disposition oder Lohnverarbeitung bereits viele wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern schafft Freiräume für Aufgaben, die Fingerspitzengefühl und menschliche Kompetenz erfordern.
So beeindruckend der Fortschritt auch ist: der Einsatz von KI wirft neue Fragen auf, gerade in einem sensiblen Bereich wie der Temporärarbeit. Denn dort, wo Entscheidungen über Menschen getroffen werden, sind Fairness und Transparenz entscheidend. Umso wichtiger ist es, die Risiken im Blick zu behalten.
Ein zentrales Thema ist die Nachvollziehbarkeit. Viele KI-Systeme liefern Ergebnisse, ohne dass genau ersichtlich ist, wie diese zustande kommen. Sie bleiben eine Blackbox – besonders heikel, wenn es um Bewerbungen, Vermittlungen oder Lohnfragen geht. Wenn Algorithmen Vorschläge machen, sollten diese nachvollziehbar und überprüfbar sein.
Hinzu kommt die Qualität der Ergebnisse. KI kann beeindruckend formulieren, Daten analysieren oder Kandidaten vorschlagen – aber sie liegt auch mal daneben. Falsche Fakten, fehlerhafte Verknüpfungen oder ungewollte Verzerrungen passieren vor allem dann, wenn die Trainingsdaten unausgewogen oder unvollständig sind. Wer sich blind auf die Maschine verlässt, riskiert unfaire Entscheidungen.
Die EU hat mit dem AI Act bereits auf diese Herausforderungen reagiert. Das Gesetz will gerade in Bereichen klare Regeln für den Einsatz von KI schaffen, die grundsätzlich Einfluss auf Menschen nehmen. Die Schweiz ist zwar nicht an die Verordnung gebunden, beobachtet die Entwicklungen aber genau. Der Bundesrat prüft derzeit, ob und wie ein eigenes Regulierungskonzept aussehen könnte. Ziel ist es, Innovation zu ermöglichen – aber nicht auf Kosten der Sicherheit oder Grundrechte.
Für die Temporärarbeit bedeutet das: Wer KI einsetzt, braucht nicht nur die richtigen Tools, sondern auch ein Grundverständnis für ihre Funktionsweise. Denn nur mit Kompetenz, klaren Standards und einem kritischen Blick lässt sich das volle Potenzial der Technologie ausschöpfen – ohne dabei Risiken aus dem Auge zu verlieren.
Fazit
Durch KI entstehen neue Spielräume: für strategisches Denken, bessere Entscheidungen und menschlichere Begegnungen. Doch dieser Wandel passiert nicht von selbst. Es braucht Offenheit, Verantwortungsbewusstsein und vor allem: die Bereitschaft, dazuzulernen. Denn die Unternehmen, die KI jetzt verstehen und sinnvoll integrieren, sind morgen nicht nur effizienter, sondern auch attraktiver für Kundschaft und Talente.
Diesen Beitrag teilen
Weitere Beiträge